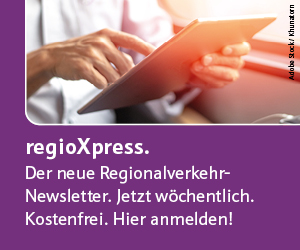Nach dem Zweiten Weltkrieg waren in Deutschland kostengünstige und leicht gebaute Triebwagen gefragt. Besonders die neu gegründete Deutsche Bundesbahn (DB) zeigte Interesse, verursachte der Dampfbetrieb auf den Nebenstrecken doch hohe Verluste. Bereits 1950 konnte die DB zwölf Prototypen des Uerdinger Schienenbusses in Betrieb nehmen, die von der Waggonfabrik Uerdingen gefertigt wurden (heute ein Produktionswerk von Siemens Mobility). Die Fahrzeuge waren erfolgreich, und schon 1952 wurden die ersten Serienwagen des Typs VT 95 an die DB geliefert.
Erfolgreiche Uerdinger Schienenbusse
Die einmotorigen Zweiachser waren 13,27 m lang, hatten einen Achsstand von 6 m und boten bei einer Dienstmasse von knapp 14 t rund 63 Sitzplätze. Motor und Getriebe stammten aus dem Omnibusbau. Mit dem VT 98 kam ab 1955 eine zweimotorige Version hinzu, da der VT 95 auf steigungsreichen Strecken schwächelte. Bis Mitte der 1960er Jahre wurden knapp 1500 Uerdinger Schienenbusse gebaut, hinzu kamen zahlreiche Bei- und Steuerwagen. Die „Retter der Nebenbahnen“ fuhren nicht nur in Deutschland, sondern auch in Luxemburg, Österreich, Jugoslawien und Italien. Bei der Deutschen Bahn (DB AG) wurden die letzten Exemplare erst im Jahr 2000 aus dem regulären Verkehr genommen.
Kommt die Schienenbus-Renaissance?
Beschert die Verkehrswende dem kostengünstigen Schienenbus in Deutschland und anderen Ländern nun ein Comeback? Aktuell liegen drei Entwürfe für zweiachsige Fahrzeuge vor, die gleich mehrere Gemeinsamkeiten aufweisen: So hat der Dieselmotor ausgedient, stattdessen werden batterie-elektrische oder Wasserstoff-Antriebe favorisiert, die einen lokal emissionsfreien Betrieb ermöglichen. Alle Fahrzeuge entstehen in Leichtbauweise und unter Zuhilfenahme von Komponenten aus dem Bus- und Straßenbahnbau. Auch die Einsatzfelder gleichen sich: Wie ihre Vorgänger aus den 1950er Jahren sind die neuen Schienenbusse vor allem für zu reaktivierende Strecken mit geringem Fahrgastaufkommen gedacht, auf denen sie als Zubringer zu vorhandenen Vollbahnstrecken dienen. Um Kosten zu sparen, sollen die neuen Nebenbahnretter – sobald dies technisch und rechtlich möglich ist – autonom fahren. Ob auch ein Mischverkehr mit Vollbahnzügen möglich sein wird, ist noch nicht final geklärt. Drei Entwürfe für Schienenbusse waren unter anderem auf der InnoTrans 2024 in Form von Bildern oder als Prototyp zu sehen.
Der „Aachener Rail Shuttle“ (ARS)
Am weitesten gediehen ist derzeit der „Aachener Rail Shuttle“ (ARS), der als Exponat auf der InnoTrans 2024 zu besichtigen war. Der Schienenbus ist 13,5 m lang, verfügt über zwei von Elektromotoren angetriebene, selbstlenkende Einzelradsätze und bietet Platz für bis zu 76 Fahrgäste. Das Chassis und die Fahrgastzelle sind zwei eigenständige Einheiten – auf diese Weise kann die Fahrgastzelle abgenommen werden und das Chassis nachts zum Beispiel als Cargo-Version mit einem Container verkehren. Zentrales Element des ARS ist die Traktionsbatterie mit einer Kapazität von 152 kWh, die auch auf topografisch anspruchsvollen Strecken bis zu 220 km Reichweite ermöglicht. Für den Fall einer Kollision verfügt das Fahrzeug über Crash-Absorber. Der Schienenbus wurde von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RTHW) Aachen entworfen, der Prototyp dort auch gebaut. Das Fahrzeug soll bis zu 100 km/h schnell sein, angestrebt wird ein Betrieb ohne Fahrer.
„DRAISY“ aus Frankreich
Weit vorangekommen ist auch der leichte Schienenbus „DRAISY“ aus Frankreich, der am 25. September 2024 auf dem Kongress der französischen Regionen in Strasbourg in Form eines Mock-ups enthüllt wurde. Das Fahrzeug wird von der elsässischen Lohr-Gruppe zusammen mit der französischen Staatsbahn SNCF entwickelt. Die aktuelle Version ist ebenfalls mit Crash-Absorbern ausgestattet und nun 14 m lang. In dem zirka 20 t schweren Fahrzeug können bis zu 80 Fahrgäste befördert werden, 30 davon sitzend. DRAISY wird batterie-elektrisch angetrieben, wobei die Reichweite mit einer Ladung bei zirka 100 km liegt. Kontaktlose Schnellladungen an den Zwischenstationen können den Aktionsradius des 100 km/h schnellen Schienenbusses erheblich erweitern. Spätestens 2027 soll ein Prototyp auf der Nebenbahn Sarralbe – Kalhausen in der Region Grand Est fahren, ab 2028 soll DRAISY international vermarktet werden.
Das „NGT-Taxi“ des DLR
Erst auf dem Papier existiert das „NGT-Taxi“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Die Abkürzung steht für Next Generation Train. Der Zweiachser soll automatisiert auf Nebenstrecken unterwegs sein – mit Batterie- oder Brennstoffzellen-Antrieb. Fahrzeugstruktur und Antriebskonzept sind modular aufgebaut und lassen sich flexibel den Gegebenheiten anpassen: Die kürzeste Variante ist knapp 10 m lang mit 12 Sitzplätzen, die längste misst 17,5 m und hat 54 Sitze. Als Betriebskonzept ist ein Taktverkehr ebenso möglich wie ein vom Fahrgastaufkommen abhängiger On-Demand-Service. Zunächst will das DLR einen Prototyp der kurzen Version bauen und auf verschiedenen Strecken testen.
Text: Regionalverkehr, Bild: Regionalverkehr